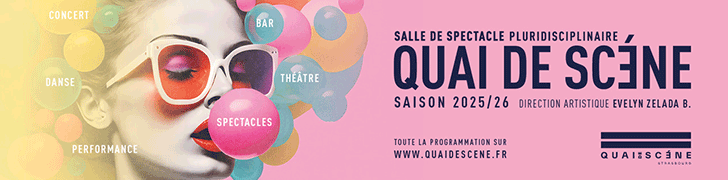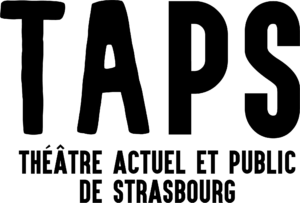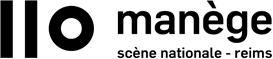Aus trauriger Nacht zum strahlendem Jubel, diesen Weg geht Thierry Malandain mit seinem Ballet Biarritz in zwei ganz unterschiedlichen Tanzstücken zu großer, bekannter Musik. Endlich ist die Ballettkompagnie, die den Namen ihres Chefchoreographen im Titel führt, auch [einmal] in Baden-Baden zu erleben: Am 10.,11. und 12. Mai 2024 tanzen sie im Festspielhaus auf Johann Sebastian Bachs „Pastorale“ und Frederic Chopins „Nocturnes“.
In seinen klaren, neoklassischen Linien, die auf flacher Sohle getanzt werden, vereint das Ballet Biarritz die Eleganz des französischen Balletts mit der Ausdruckskraft des zeitgenössischen Stils. Choreograf Thierry Malandain glaubt an die Schönheit des klassischen Tanzes, an Strukturen und große Formationen.
Frédéric Chopins melancholisch glitzernde Nocturnes gehören zur Lieblingsmusik vieler Choreographen. Thierry Malandain versteht die Klavierstücke nicht nur als elegante Nachtmusik, sondern sieht in ihnen eine Verbindung zur schwarzen Romantik. Man mag in der Prozession kurze Szenen erkennen, Klage und Schmerz, vor allem aber herrscht auf diesem schmalen Streifen des Lebensweges eine leis-akzeptierende Melancholie. Mit den Worten des Dichters Charles Baudelaire versteht Malandain sein Ballett als „den Schatten eines schwarzen Tages, trauriger als die Nächte“.
Der zweite Teil des Ballettabends, Malandians „La Pastorale“ zeigt dann zu Beethovens gleichnamiger Sinfonie ein helles, strahlendes Arcadia, das aus dem Dunkel einer geometrischen Metallstruktur hervorgeht, in der die Tänzer anfangs regelrecht gefangen sind. Die Enge weitet sich zur großen Freiheit, Schwarz wird zu Weiß, die Beklemmung klärt sich zu wirbelnden, neuen Ordnungen. Aus der sechsten Sinfonie des Komponisten, der Beethoven den Zusatz „Erinnerungen an das Landleben“ mitgab, macht der Choreograph eine Art Dreischritt, indem er der „Pastorale“ Ausschnitte des Festspiels „Die Ruinen von Athen“ voranstellt und nach der Sinfonie folgt die kurze Kantate „Meeresstille und glückliche Fahrt“ zu zwei Gedichten von Johann Wolfgang von Goethe.
Ein Metallgitter aus quadratischen „Zellen“, so hoch wie Ballettstangen, hält die Tänzer gefangen. Ein einzelner, schmaler Mann entpuppt sich nach und nach als der (Anti-)Held des Stückes. Wenn er in gebückter Haltung und in sich gekehrt um das Quadrat rennt, dann könnte man ihn wohl für den verzweifelten, ertaubenden Beethoven halten, der sich, gehalten und geplagt von dunklen Engelsgestalten, alsbald in sein eigenes Arkadien träumt, an einen Ort der apollinischen Klarheit und Schönheit. Malandain feiert die Harmonie der Gemeinschaft und das zivilisierte Miteinander, das Streben nach Frieden und die Schönheit des menschlichen Körpers. Nach jedem Satz der Sinfonie liegt der einsame Held wieder am Boden, zum Schluss kehrt er aus seinem Traum vom Paradies in die Realität zurück – nur um dann vollkommen in der Gemeinschaft aufzugehen. Den großen, unverstellten Menschheitsjubel am Ende kennt man sonst nur von Maurice Béjart oder John Neumeier, er mag in Zeiten wie diesen anachronistisch wirken – aber genau wie Beethovens Musik wirkt er ungemein tröstlich.