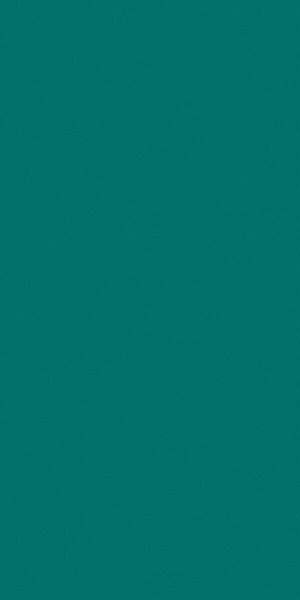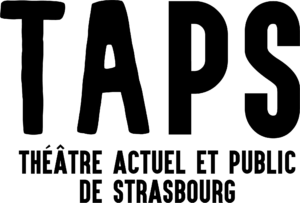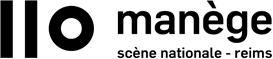Burleske Hoffnungslosigkeit
Jean-Pierre Vincent inszeniert Warten auf Godot und gibt uns damit alle Schichten und Textfeinsinnigkeiten Becketts zu sehen und zu hören.
Im Vorlauf sollte zunächst daran erinnert werden, dass Jean-Pierre Vincent einen ganz bestimmten Platz in Straßburg besetzt. Direktor des TNS von 1975 bis 1983, wandelte er es in einen der Hauptorte für Kreation und Experimente um. Seitdem kommt er regelmässig mit seinen Stücken zurück und hat zudem die Gruppe 39 der Schule (er war selbst dort Schüler) bei ihrer ersten Inszenierung begleitet. Das Straßburger Publikum ist daher mit seiner textnahen Darstellungsform, die oft von kritischer Ironie beeinflusst ist, vertraut.
Auch dieses Mal können wir all die Scharfsinnigkeiten des Beckettschen Stückes hören. Enstanden zwischen 1948 und 1949, bezieht sich der Text am Kriegsende, welches Beckett ins Exil zwang, auf keinen Kontext oder eine Periode, um sich mit der fondamental beraubten Menscheit auseinander zu setzen. „Wir existieren und wir sind nicht klein zu kriegen“, erklärt Vincent. „Wir werden bis zum Ende gehen.“ Und präzisiert „Wir sind hier und wir können nicht damit Schluss machen, also warten wir. Und da wir schon einmal da sind und warten, müssen wir es auch benennen. Sie haben es Godot genannt.“ Und gegenüber einer Welt, dessen Ende man errät, ist die Situation hin-und wieder extrem komisch und burlesk
Beckett hat dieses Stück auf Französisch geschrieben. Es ist daher von allem Überflüssigen befreit, um dem Sprachrhythmus zu folgen. Mit seinen 5 Schauspielern integriert Jean-Pierre Vincent ein paar klar erkennbare Bezüge zu Buster Keaton, Laurel & Hardy und Charlie Chaplin in diesen zeitgenössischen Klassiker, die dem Text eine durch die Fragen nach dem Warten und der Einsamkeit oft vergessene Dimension geben. Was wieder einmal zeigt, dass man Klassiker nie ausgelesen hat… (S.D.)
Weitere Informationen
- Eine Kritik des Stückes in der Zeitung Libération
- Jean-Pierre Vincent à propos zu Warten auf Godot auf CultureBox